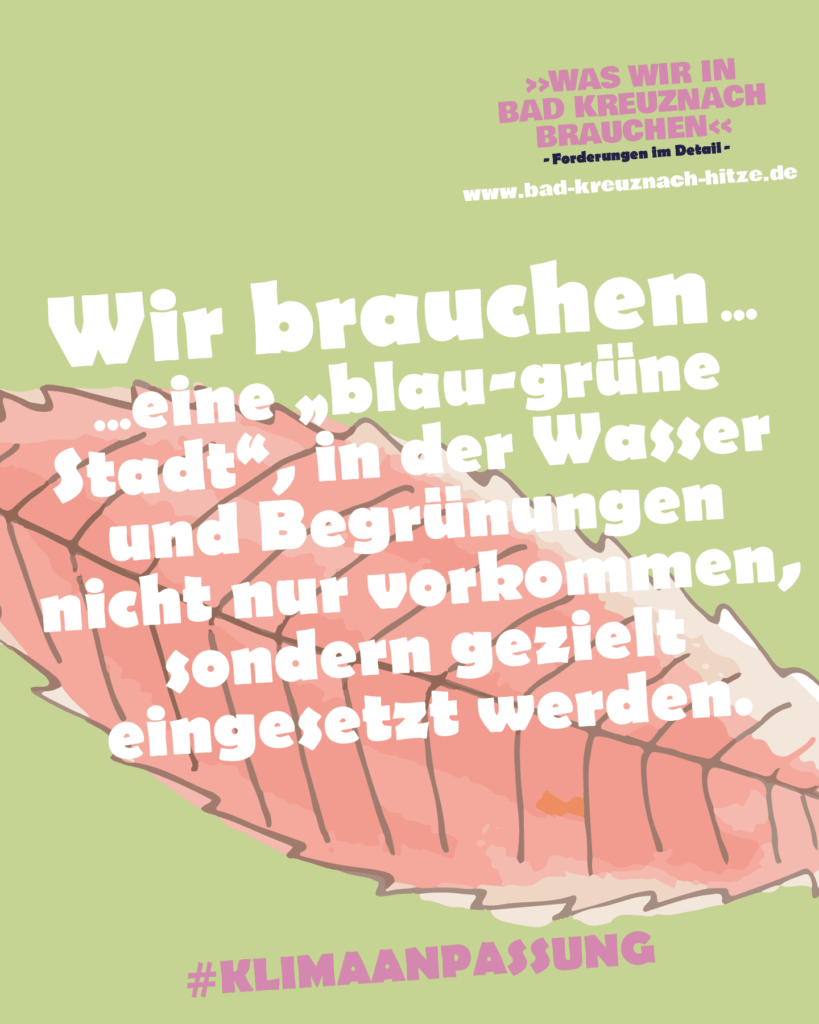Maßnahmen für Bad Kreuznach
Je nachdem, wie der Klimawandel fortschreitet, liegen die zukünftigen Kosten bis 2050 zwischen 280 und 900 Milliarden Euro. – Die Bundesregierung
Das Bundes‑Klimaanpassungsgesetz (KAnG), das am 1. Juli 2024 in Kraft trat, verfolgt das übergeordnete Ziel, die Folgen des Klimawandels für Menschen, Umwelt, Wirtschaft und Infrastruktur möglichst zu vermeiden oder abzumildern. Es soll die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Natur stärken, um regionale Unterschiede bei den Lebensverhältnissen auszugleichen. Gleichzeitig verpflichtet das Gesetz dazu, soziale Ungleichheiten, die durch die Auswirkungen des Klimawandels entstehen , gezielt zu verhindern.
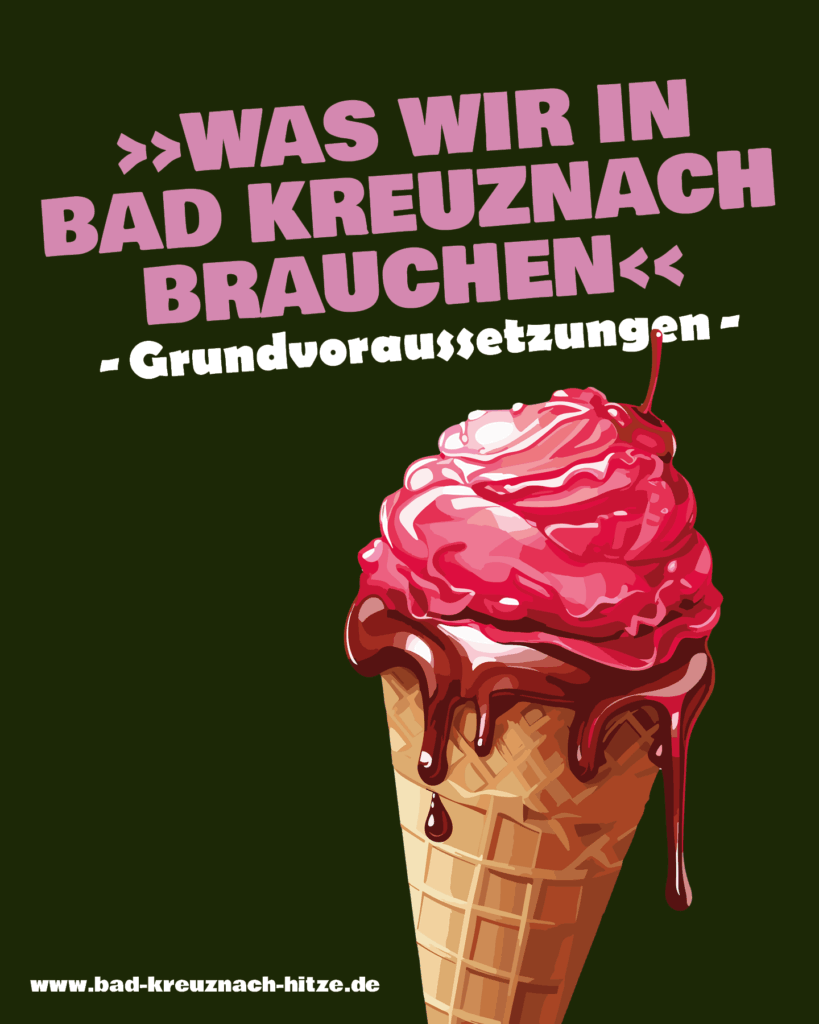
„DIE HITZE-RESILIENTE-STADT“:
Für die folgenden drei Hitzeschutz-Grundvoraussetzungen ist ein qualifiziertes Klimaanpassungsmanagement dringend erforderlich:
1) Öffentlichkeitsarbeit
Hitze muss als Risikofaktor stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Ziel ist es, ein allgemeines Verständnis für die Gefahren extremer Temperaturen zu schaffen und besonders auf Risikogruppen hinzuweisen, die durch den Klimawandel besonders bedroht sind. Die Stadtverwaltung und die Politik sind in der Pflicht, zu zeigen, dass sie sich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Alle Informationen sollten barrierefrei zugänglich sein, sodass die Bürger:innen sie ohne Hindernisse abrufen können. Zusätzlich sind barrierefreie Kommunikations- und Meldestellen wichtig, die auch dafür sorgen, dass ein dauerhaftes Hitzemonitoring in Bezug auf die Hitzewahrnehmung stattfindet.
2) Barrierefreies Hitzewarnsystem
Ein barrierefreies Hitzewarnsystem muss die Teilhabe aller Menschen ermöglichen, besonders durch eine differenzierte Berücksichtigung vulnerabler Gruppen und ihrer spezifischen Bedürfnisse. Es sollte entsprechend auch für Menschen mit Sehschwäche geeignet und in einfacher Sprache zugänglich sein. Die wichtigsten Kriterien dabei sind die flächendeckende Verfügbarkeit, Sichtbarkeit, eine gute Erreichbarkeit und die klare Verständlichkeit. Hitze muss als Gefahrenfaktor genauso ernst genommen werden wie Überschwemmungen oder Orkane.
3) Inklusive Hitzeaktionspläne
Inklusive Hitzeaktionspläne müssen die spezifischen Bedürfnisse vulnerabler Gruppen berücksichtigen und einen allgemein gültigen Fahrplan für extreme Hitzetage bieten. Diese Pläne sollten auf Verwaltungsebene bekannt und erprobt sein, um im Ernstfall schnell und effektiv zu reagieren. Wichtige Bestandteile sind hitzekompensierende Maßnahmen sowie Ansätze zur Förderung der Resilienz. Die Datenerhebung und wissenschaftliche Begleitung sichern eine kontinuierliche Optimierung und Anpassung der Maßnahmen.
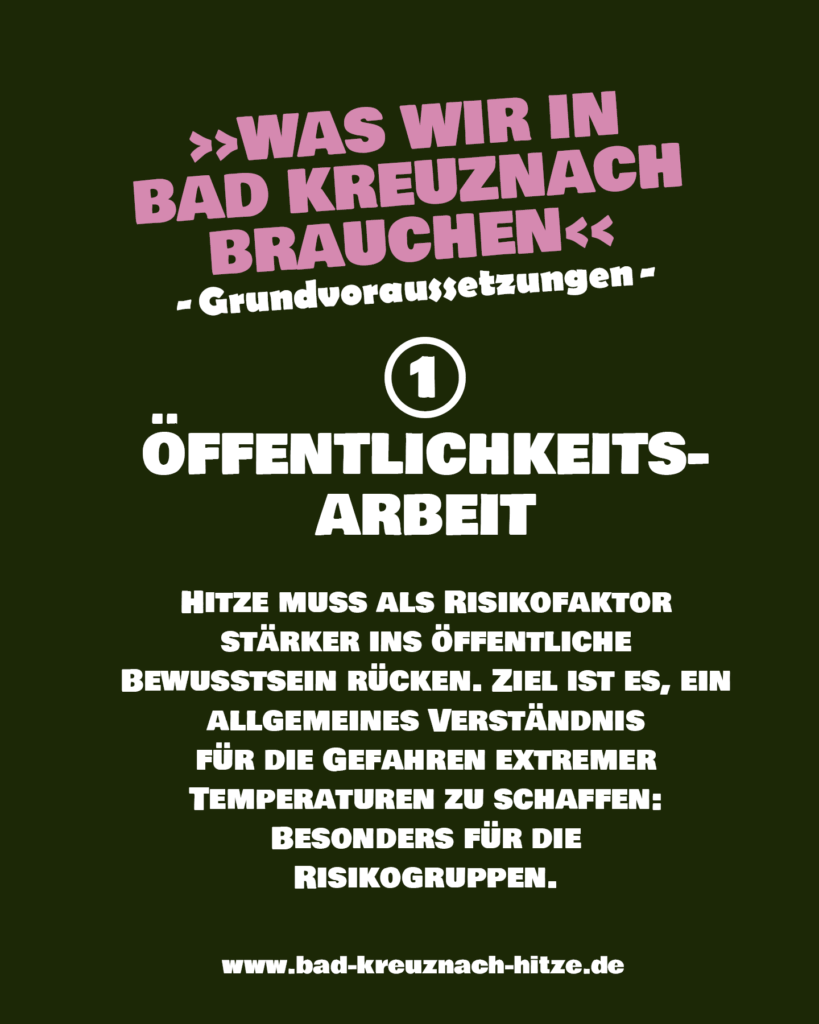
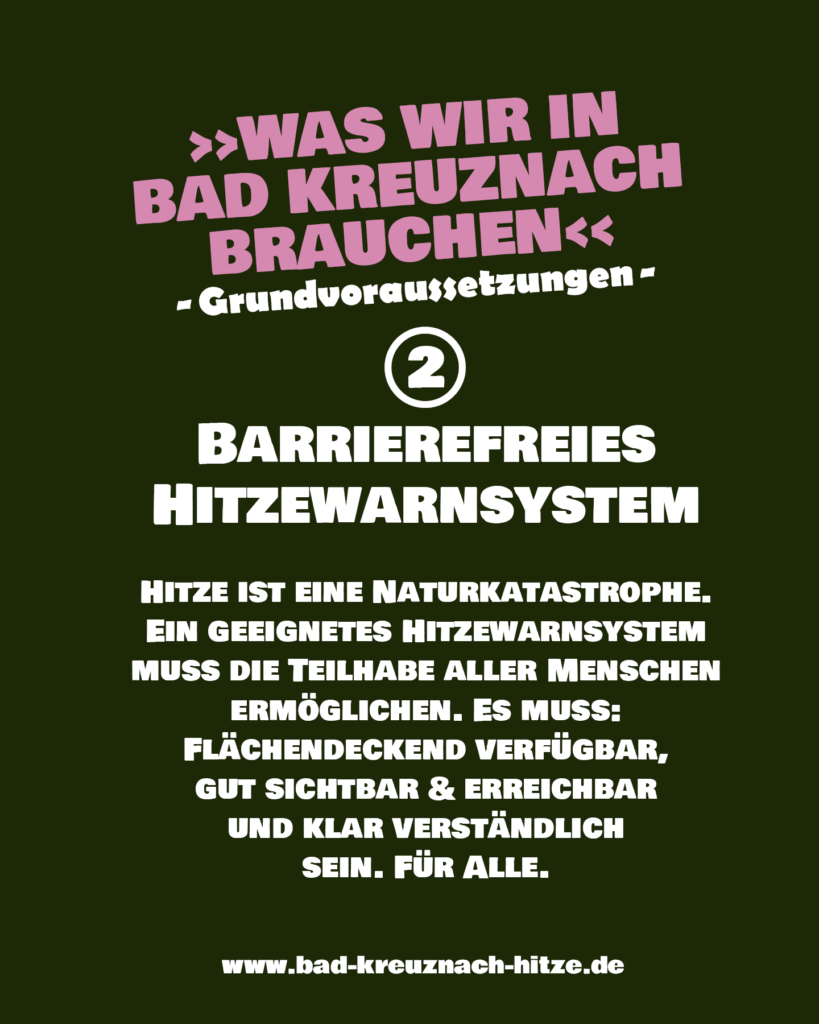
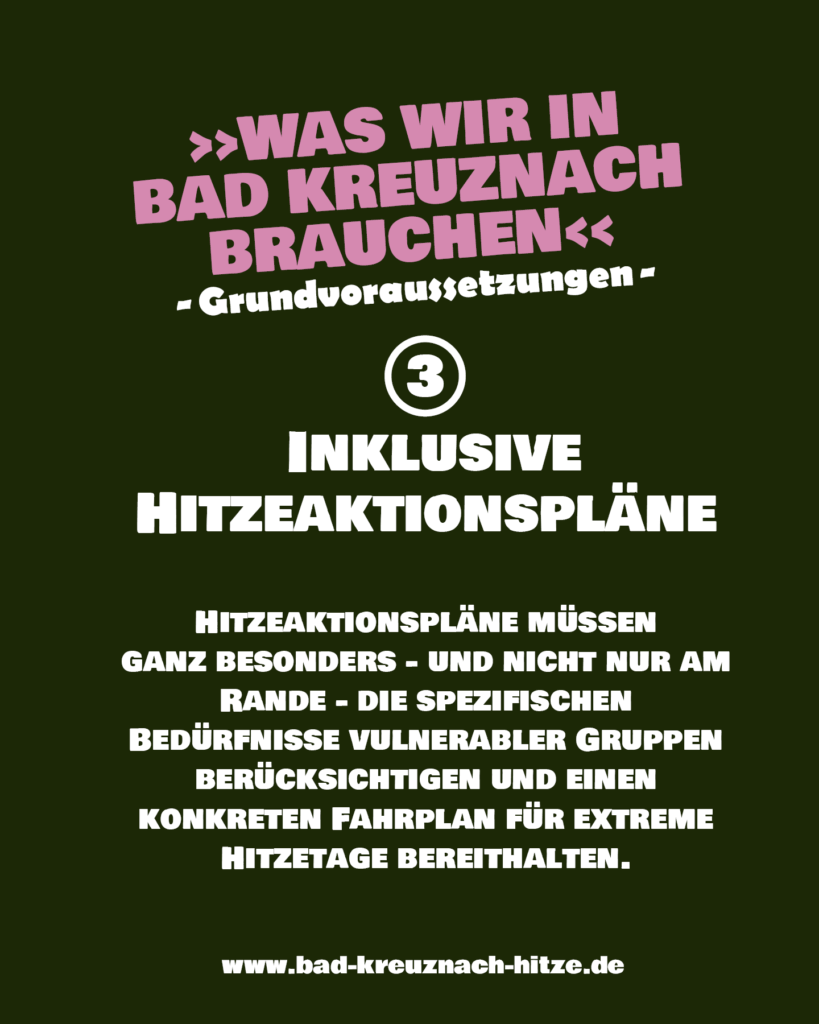
„DIE BLAU-GRÜNE-STADT“:
Natürlich sind die drei oben genannten Grundbedingungen nicht ausreichend, um Bürger:innen vor zunehmenden Hitzewellen zu schützen. Ein Klimaanpassungsmanagement hat auf dieser Grundlage die vielfältige Aufgabe konkrete Hitzeschutzmaßnahmen in die Wege zu leiten.
Dazu gehören zum Beispiel:

Entsiegelung
Mehr Freiflächen und durchlässige Böden verbessern die Wasseraufnahme und fördern die Verdunstung. Desweiteren speichern Versiegelte Flächen wie Asphalt und Beton Wärme und tragen zur Entstehung von städtischen Wärmeinseln bei. Durch Entsiegelung wird der Anteil dieser Flächen reduziert, was zu einer niedrigeren Lufttemperatur führt.
Begrünung und der Erhalt von Baumbeständen
Grüne Wände, Begrünung von Dächern und das Pflanzen von Bäumen sorgen für Schatten, reduzieren die Hitzebelastung durch absorbierte Strahlung und binden CO₂ (CO₂-Senken). Außerdemkompensieren Grünflächen Luftverschmutzung deutlich und reduzieren zudem die Lärmbelastung. Bereits anspruchslose Pflanzen wie Kryptogame(blütenlose Pflanzen), das sind zum Beispiel Moose, Farne und Flechten, überleben auch auf sonnenreichen, nährstoffarmen Flächen und filtern Stickstoff sowie Schwermetalle aus der Luft.
Tiny Forests
Selbst auf kleinen Flächen mit dichten Baumbeständen wird das Pflanzenwachstum und die Planzenvielfaltgefördert. Eine dichte Begrünung schützt vor Erosion, Hitze und schnellem Wasserverlust, spendet zudem Schatten und Verdunstungskühle im Sommer. Der Boden bleibt deutlich feuchter, nimmt bei Regen mehr Wasser auf und schützt Wurzeln und Stamm vor Hitze.
Mosaikartige Biotopvernetzung
Verbindungen zwischen Grünflächen und Habitaten für Vögel, Kleinsäuger, Insekten und Mikroorganismen sind entscheidend für ein funktionierendes Ökosystem. Denn diese Arten erfüllen Ökosystemleistungen wie Zersetzung und Bestäubung und sind gleichzeitig Nahrungsquellen für andere Tiere. Durch die Vernetzung der Grünflächen können sich Tiere also besser ausbreiten, Samen transportieren und Schädlinge bekämpfen.
Erhalt von Baumbeständen:
Baumbestände müssen erhalten werden da ihre derzeitige Ökosystemleistung für ein erträgliches Stadtklima unabdingbar sind. Die Verantwortung für einen ausreichenden, idealerweise zusammenhängenden Baumbestand zu sorgen, ist in der Stadt naturgemäß größer als in ländlichen Gebieten. Ohne Frage ist der Erhalt solcher Flächen im städtischen Gebiet mit Aufwand verbunden. Dennoch bleiben sie alternativlos und gleichzeitig wirksamer und kosteneffizienter als technische Alternativen. Eines der größten Probleme ist, dass vermeintlich hohe Kosten und einen durchgehend professionellen Umgang oftmals mahnend an erste Stelle gestellt, der Wert von Baumbeständen langfristig aber falsch kalkuliert wird: Dabei ist nachweisbar, das Fehler bei der Bewirtschaftung der Baumbestände wie übermäßige Rodungen, unsachgemäße Rückschnitte oder das vernachläsigen von Ausgleichsflächen für eine deutliche verschlechterung der Wirtschaftlichkeit sorgen, da langfristig die Energie- und Gesundheitskosten gesteigert werden und Arbeiten (z.B. durch Pilzbefall) vermehrt anfallen.
Schwammstadt
Das Schwammstadt-Konzept ist ein Ansatz zur nachhaltigen Stadtentwicklung, der darauf abzielt, Regenwasser effizient zu speichern und bei Bedarf wieder verfügbar zu machen. Anstatt Wasser schnell über Kanalisation abzuleiten, wird es gezielt in Boden, Grünflächen und wasserdurchlässige Beläge aufgenommen. So wirkt die Stadt wie ein Schwamm, der Wasser aufnimmt, speichert und bei Trockenheit an die Umgebung abgibt. Dies schützt vor Überschwemmungen bei Starkregen und sorgt für kühlende Effekte bei Hitze, verbessert das Mikroklima und entlastet das städtische Entwässerungssystem.
Frischluftschneisen
Frischluftschneisen sind gezielt angelegte oder erhaltene Freiräume in städtischen Gebieten, die den natürlichen Luftaustausch fördern und kühle, frische Luft in die Stadt leiten. Diese Schneisen – oft Grünflächen, Parks oder unbebaute Korridore – unterstützen den Luftfluss aus dem Umland und tragen zur Abkühlung der städtischen Mikroklimata bei, besonders an heißen Sommertagen. Durch die Kühlung und Luftzirkulation helfen Frischluftschneisen, Hitzeinseln zu reduzieren, verbessern die Luftqualität und erhöhen die Lebensqualität in dicht bebauten urbanen Räumen.